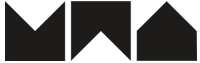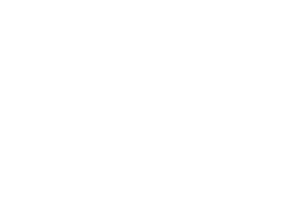TYPUS
Alle
Auswahl
Häuser
Öffentlich
Städtebau
mit Bestand
STATUS
Alle
Realisiert
JAHR
Alle
2018
2020
2021
2022
2023
2024
2025
TYPUS
Alle
Auswahl
Häuser
Öffentlich
Städtebau
mit Bestand
STATUS
Alle
Realisiert
JAHR
Alle
2018
2020
2021
2022
2023
2024
2025